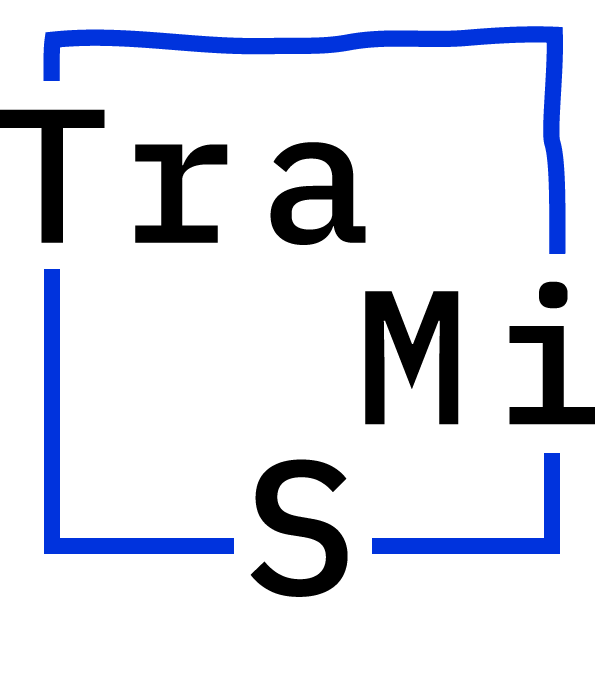Fächer
Unsere Kategorie "Fächer" beinhaltet alle weiterführenden Informationen zu den Fachangeboten am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bremen. Klicken Sie auf die Titel in der untern stehenden Liste um zu den einzelnen Fachinformationen zu gelangen.
Musik
Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit
Henry Wadsworth Longfellow
Aus Liebe zur Musik
Musik verbindet, Musik ist integrativ, Musik bewegt. In unserem alltäglichen Leben kommen wir – auch aufgrund von modernen Medien – ständig mit Musik in Berührung. Wir hören Musik, bewegen uns zu Musik und machen Musik – allein oder mit anderen. Musik ist Sprache, international. Sie ermöglicht stille Besinnung und harmonisches Miteinander gleichermaßen. Musik fördert die Wahrnehmung, sie aktiviert den ganzen Körper und schult vor allem auch die Kooperationsfähigkeit. Sie setzt Bildungsprozesse in Gang, indem sie Phantasie anregt, das Denken schult, Selbstständigkeit fordert, Problembewusstsein weckt, Beharrlichkeit verlangt und Hingabe voraussetzt. Musik gründet auf Können. Können wiederum beruht auf Wissen, auf Kreativität, auf Übung und auf der Fähigkeit, zwischen „ratio“ und „emotio“ ausgleichen zu können. Kombiniert mit einer ordentlichen Portion Kreativität und Offenheit entsteht ein Schulfach, das viele individuelle Zugänge für verschiedene Typen von Lernenden bietet.

Ziele
Im Fokus steht die Vermittlung musikalischer Grundkenntnisse und Kompetenzen. Diese sollen möglichst schülernah und praxisorientiert vermittelt werden. Ebenso ist es das Ziel vorhandene instrumentale und vokale Fähigkeiten zu fördern als auch interessierte bzw. „talentierte“ Schüler zu entdecken und zu unterstützen.
Inhalte
Musikgeschichte aus Vergangenheit und Gegenwart (Musik‐ Epochen) ebenso vermittelt wie Grundlegende Aspekte der Musiktheorie (u. a. Notenlehre, Rhythmus, Harmonik). Auch soll die Auseinandersetzung mit wesentlichen Formen und Stilen in den Bereichen Klassik, Jazz, Pop‐ und Rockmusik nicht zu kurz kommen. Somit soll jeder Schüler ein umfangreiches Wissen über Notenlehre, Musik‐ Epochen und Werkformen erhalten.
Mittelstufe
Der Unterricht im Fach Musik erfolgt regulär in den Jahrgängen 6 und 8 mit je 2 Wochenstunden. Hier steht die Vermittlung von musikalischen Grundfähigkeiten im Fokus: dies erfolgt durch Singen von bekanntem und weniger bekanntem Liedgut aus aller Welt, der praktischen Umsetzung von Rhythmen mit Körper, Stimme und Instrumenten sowie der Einführung in den Umgang und das Spiel von Instrumenten wie zum Bspl. der Gitarre, dem Schlagzeug, der Cajon oder aber auch dem Klavier. Theoretische Phasen, die sich mit den Grundlagen der Musiktheorie (Bsp. Notenlehre) oder dem Rhythmus beschäftigen, wechseln sich stets mit praktischen Phasen des Ausprobierens sowie der gemeinsamen Umsetzung in der Gruppe ab. Auch das Erlernen des richtigen Singens (Atemtechnik, Stimmvolumen usw.) ist wesentlicher Teil des Musikunterrichts.

Des Weiteren gilt es, sich mit den gesellschaftlichen Kontexten von einer großen Vielfalt von Musik auseinanderzusetzen: dies erfolgt unter anderem im Rahmen des Kennenlernens von Komponisten wie z.B. Haydn oder Mendelssohn und am Bspl. ausgewählter Kompositionen sowie durch die Beschäftigung mit Musik aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Aber auch die Musik aus dem natürlichen Umfeld der Schüler wird bspw. im Kontext der Entwicklung der Pop‐ und Rockmusik oder der Wirkung von Musik (Bsp. Musik und Werbung) genauer unter die Lupe genommen. Das Ziel: Neugierde wecken, Wissen erlangen und hinterfragen und musikalische Hörgewohnheiten aufbrechen.
Oberstufe
In der Oberstufe ist das Fach Musik keinem Profil zugeordnet und kann über die freie Schiene als Grundkursfach mit 2 Wochenstunden angewählt werden. Entscheidet man sich für Musik, erwartet den Schüler ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm.
Im Bereich der Musikpraxis erfolgt eine weiterführende Auseinandersetzung mit den in der Mittelstufe eingeführten Instrumenten mit dem Ziel der Einstudierung von Arrangements im Kurs. Auch der Umgang mit der eigenen Stimme als Möglichkeit des individuellen musikalischen Ausdrucks ist weiter Gegenstand des Unterrichts.
Im Bereich der Musiktheorie findet eine Vertiefung und Erweiterung des bereits erworbenen Wissens über Notenlehre, Rhythmus, Harmonie und Gattungen, wie beispielsweise der Sinfonie oder des Kunstliedes statt. Das erworbene Wissen kommt zur Anwendung in der genaueren Betrachtung/Analyse verschiedener Instrumental‐ und Vokalformen wie bspw. der Sonatenhauptsatzform, dem Motiv oder dem Kunst‐ und Volkslied.
Neben der Fähigkeit unbekannte Musikwerke genauer zu analysieren, ist es Ziel eigene kleine Kompositionen wie zum Bspl. Songs zu realisieren (Songwriting) und auch vorhandene Werke (Bsp. Lieder) zu transponieren. Des Weiteren steht u. a. die Auseinandersetzung mit dem Apparat der Musikindustrie am Beispiel des Musikvideos auf dem Plan: durch die praktische Gestaltung von eigenen Videos wird nicht nur die Kreativität gefördert, sondern auch das Bewusstsein für die schrittweise und geplante Umsetzung des künstlerischen Prozesses geprägt.
Als Schwerpunkte beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in der Q1 und Q2 mit folgenden Kursthemen:
- Die Verbindung von Musik mit außermusikalischen Aspekten (Bsp. Filmmusik)
- Musik im Wandel der Zeit (Bspl. Musiktheater)
- Musik des 20./21. Jahrhunderts (Bspl. Songwriting)
- Musik im gesellschaftlichen Kontext (Bsp. Musik und Politik, Punk)
Als Ziel könnte hier ggf. auch die Vorbereitung auf die Wahlmöglichkeit der praktischen Prüfung im Rahmen der mündlichen Abiturprüfung ins Auge gefasst werden.
Arbeitsgemeinschaften
In den angebotenen Arbeitsgemeinschaften haben Schülerinnen und Schüler zusätzlich die Gelegenheit, gemeinsames Musizieren und Singen nach Lust und Laune auszuprobieren und ggf. bei Schulveranstaltungen mitzuwirken.
Veranstaltungen
Die Schüler haben die Möglichkeit sich mit ihren Fähigkeiten und Talenten bei der Gestaltung der verschiedenen Veranstaltungen im Schuljahr mit einzubringen. U. a. durch die Gestaltung und Mitwirkung bei:
- der Weihnachtsfeier für den 5.und 6. Jahrgang
- dem jährlichen Schulfest
- der Einschulung der 5. Klassen nach den Sommerferien
- dem Infotag im Januar
- im besonderen Maße bei der Abschlussfeier der Abiturienten.
Nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne ist der Fachbereich Musik präsent. Hier in Form von Ton und Technik ohne die heute keine größere und auch manch kleinere Veranstaltung nicht funktionieren würde. Auch hier engagieren sich Schüler (Tontechnik AG) und sind begeistert dabei.
Projekte/Kooperationen
Der Fachbereich Musik wirkt mit oder ist Initiator bei verschiedenen Projekten und arbeitet in Kooperation mit den umliegenden Grundschulen zusammen. Hier ein kleiner Auszug:
- 2015: Jahrgang 6 dabei bei „Klasse wir singen“ in der ÖVB Arena Bremen
- 2016: Opernprojekt: wir kochen eine Oper a la Rossini
- 2015/16 Cajonbauprojekt: Schüler der 4. Klasse der Grundschule Grolland und Schüler des 6. Jahrgangs bauten nicht nur gemeinsam Cajons sondern brachten diese im Anschluss auch lautstark zum klingen auf dem Infotag im Januar 2016 und auf dem Frühlingskonzert im Mai 2016.
- 2016/17 Kooperation zusammen mit der Grundschule Delfter Strasse unter dem Motto: Komposition in „Neue Musik“. Interessierte Schüler beider Schulen bekommen die Möglichkeit unter professioneller Anleitung des Komponisten Mehran Sherkat Naderi sich kompositorisch selbst zu betätigen. Die Ergebnisse sollen in Form eines Konzertes im Sommer 2017 präsentiert werden. Wir sind gespannt!
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.
Friedrich Nietzsche
Geographie
„Die gefährlichste Weltanschauung ist die, die die Welt nicht angeschaut hat.“ sagte einst Alexander von Humboldt, der Namensgeber unserer Schule und Mitbegründer der modernen wissenschaftlichen Geographie. Nun lässt sich die Welt aus verschiedenen Perspektiven betrachten: Zum einen sind dies physische Prozesse (Physiogeographie: natürliche Bestandteile, Strukturen und Prozesse der Erdoberfläche), zum anderen der Einfluss des Menschen (Humangeographie: Bevölkerungsentwicklung, soziale Strukturen, Wirtschaftsstrukturen, etc.). Darüber hinaus betrachten wir in der Geographie das Zusammenwirken von Mensch und Natur. Wir arbeiten also immer an aktuellen Themen, die uns alle betreffen.
Mittelstufe
In Jahrgang 5 und 6 kommen Schüler bei uns erstmalig im Fach WUK in Kontakt mit geographischen Inhalten (Grundlagen, Kartenarbeit,…). Das Fach Geographie wird am AvHG verbindlich 2-stündig in Jahrgang 7 und 8, sowie epochal 2-stündig in Jahrgang 9 unterrichtet. Darüber hinaus gibt es in Jahrgang 9 einen Wahlpflichtkurs Geographie.
Jahrgang 5 und 6 (WUK)
- Atlasarbeit (Kennenlernen von verschiedenen Kartentypen, Legende, Erschließungshilfen (Register, Kartenverzeichnis)
- Maßstab
- Topographische Grundlagen (Deutschland und seine Nachbarländer, Kontinente und Ozeane)
- Orientierung im Gelände (Himmelsrichtungen, Kompass)
Jahrgang 7
- Planet Erde (1): Erdachse, Äquator, Gradnetz der Erde
- Orientierung im Atlas und der Welt: Karten finden im Atlas, Karten auswerten, Deutschland und Bundesländer, Nachbarstaaten, Länder der Welt und Hauptstädte, Kontinente und Meere/Ozeane
- Exogene Prozesse: Gebirgsbildung, Plattentektonik, Vulkanismus, Erdbeben, Tsunamis
- Endogene Prozesse: Formung der Landschaft durch Flüsse, Meere, Erosion, Eiszeiten
- Einfluss des Menschen: Flussbegradigung, Versiegelung, …
Jahrgang 8
- Planet Erde (2): Bahn der Erde um die Sonne, Neigung der Erdachse, Entstehung von Jahreszeiten, Tageslängen, Wende- und Polarkreise, ITC, Wasserkreislauf
- Wetter/Klima bzw. atmosphärische Prozesse: Entstehung von Temperatur, Niederschlag, Globale Windsysteme, kalte und warme Meeresströmungen, natürlicher Treibhauseffekt
- Klima- und Vegetationszonen der Erde, ggf. Besuch des Klimahauses 8° Ost in Bremerhaven
- Veränderung der Natur durch den Menschen: Abholzung des tropischen Regenwaldes, Alpen/Skigebiete, …
- Wirtschaftliche und soziale Strukturen in verschiedenen Naturräumen: Lappen in Sibirien, Samen in Finnland, Landwirtschaft im Sahel/Landwirtschaft in Spanien vs. Wasserverbrauch, …
- Das Prinzip der Nachhaltigkeit: Agroforstwirtschaft in den Tropen, Bio-Sprit, Massentourismus im Mittelmeerraum, …
Jahrgang 9
- Migration
- Begriffliche Abgrenzungen (Emigration, Immigration, Permigration)
- Push- und Pull-Faktoren (Erzwungene und freiwillige Wanderung)
- Kategorisierung von Ursachen für Migration (wirtschaftliche, politische, religiöse, natürliche, persönliche Motive (Ursachen))
- Folgen für Herkunft- und Zielländer (Stichwort „brain drain“)
- Aus einem Raum ein exemplarisches Beispiel behandeln
- Globalisierung
Klassifikationsmöglichkeiten von Ländern- BIP, BNE, HDI – Was ist richtig?
- Happy Planet Index, Happy Life Index, Big Mac Index, I-Phone-6-Index, ökologischer Fußabdruck
- Projekt: Der Weg eines Produkts
- SuS entscheiden sich selbstständig für ein Produkt aus ihrem Alltag (Konsumgegenstände, z.B. Laptop/Smartphone (Elektronikindustrie), Sneakers (Textilindustrie), Autos (Automobilindustrie)
- Anhand von Internetrecherchen und Arbeitsmaterial von seitens des Lehrers erarbeiten sie sich einen Überblick zu den einzelnen Stationen ihres Produkts: Rohstoffbeschaffung, Produktion, Logistik, Vertrieb, Verkauf, Entsorgung (Recycling)
Jahrgang 9 (Wahlpflicht-Kurs)
Im Wahlpflichtkurs Geographie in Jahrgang 9 können als Ergänzung zu dem eigentlichen Geographieunterricht Themen bearbeitet werden, die ansonsten aufgrund der Stundentafel nur oberflächlich bzw. gar nicht behandelt werden würden. Hierüber sollen die Schüler unterschiedliche Kompetenzen erlangen, etwa, wie das menschliche Verhalten hinsichtlich des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen (am Beispiel des Wassers) zu beurteilen ist. Weiterhin kann es darum gehen, sich mit anderen Szenarien der Zukunft auseinanderzusetzen und auch diese kritisch zu betrachten (Energieerzeugung; Recyclingwirtschaft).
Schließlich werden geografische Arbeitsmethoden und -techniken über den Pflichtunterricht hinaus geübt und vertieft (z. B. Auswertung von komplexen Karten).
- Themenblock: Szenario 1: Ressource Wasser
- Stehen bald Kriege ums Wasser an?
- Privatisierung von Trinkwasser
- Planspiel „Keep Cool“: Klimawandel
- Unterrichtseinheit „Wasser ist für alle da! Oder?“ (von 3/4Plus)
- (ggf. 3/4plus GPS-Tour „WeserStrom“; ggf. Unterrichtseinheit „Virtuelles Wasser – 2.400 Liter Wasser für einen Hamburger?“)
- Themenblock: Szenario 2: Energieversorgung
- Internet und Strom – Gegenseitige Abhängigkeit
- Ohne Internet – Geht das noch?
- Stromnetze der Zukunft (Intelligent und bezahlbar?)
- Fukushima - Japans Energieversorgung der Zukunft
- Elektroautos
- Themenblock: Industrielle Produktion am Beispiel von Mercedes
- Gibt es hier noch Arbeitsplätze in der Zukunft oder nehmen uns Roboter/Maschinen alles weg?
- Arbeitgeber in Bremen
- Weitere Zulieferer
- Themenblock: Szenario 3: „Go Green“
- Stadtentwicklung im Sinne der Nachhaltigkeit
- Städtische Projekte
- Lokale Entwicklungsmöglichkeiten
- Energieversorgung
- Themenblock: China
- Stellung in der Weltwirtschaft, Potential
- Gegensatz Stadt-Land
- Entfernungen und Dimensionen
Oberstufe
In der Oberstufe wird das Fach durchgängig unterrichtet. Dabei gibt es ab der Q-Phase den Leistungskurs im Profil E: „Raum und Zeit“ (kombiniert mit den Grundkursen Geschichte und Deutsch) und einen Grundkurs, der frei in jedem Profil gewählt werden kann.
E-Phase (Jahrgang 10)
- Rohstoffe (exemplarisch: Vorkommen/ Verteilung, Gewinnung, Verarbeitung und Recycling; Rohstoffabhängigkeit)
- Weltwirtschaft (Stichwort: global players)
- Nachhaltigkeit (klimatische Prozesse, Klimaschutz, Tragfähigkeit der Erde an Fallbeispielen. Innerhalb dieses Themenkomplexes findet eine Exkursion ins Klimahaus Bremerhaven statt)
Q-Phase (Jahrgang 11 und 12)
Im Rahmen des Leistungs- und Grundkurses Geographie ist es zunächst verbindlich, im ersten Halbjahr der Q-Phase die „Grundfragen der Geographie“ im Unterricht zu behandeln. Darunter fallen alle physisch-geographischen Themenaspekte, die auch in der Mittelstufe Gegenstand des Unterrichts waren. Hierzu gehören Kräfte, die von innen oder außen auf die Erdoberfläche einwirken und sie somit gestalten (u. a. sind dies plattentektonische Prozesse (Vulkanismus, Erdbeben, Tsunamis), Verwitterungsprozesse (chemisch/physikalisch) und exogene Kräfte (Wasser, Eis, Wind, Sonne)). Weiterhin beschäftigen wir uns mit atmosphärischen Prozessen (Klimafaktoren, Klimaelementen) und klimatologischen Grundlagen bzw. Besonderheiten, z. B. Prozesse der Bodenbildung, Corioliskraft oder Reliefwüsten.
Da wir als Menschen einen Teil dieser Vorgänge darstellen, wird auch Wert darauf gelegt, immer einen Bezug zwischen der Umwelt, dem Raum und dem Menschen herzustellen. Gesichtspunkte sind hier: Bodendegradation, Desertifikation, anthropogener Treibhauseffekt.
In den folgenden drei Halbjahren der Q-Phase werden folgende Oberthemen behandelt:
- Globalisierung / Weltwirtschaft
- Tragfähigkeit und nachhaltige Entwicklung
- Stadt- und Wirtschaftsgeographie
Angestrebt wird dabei, dass die Schülerinnen und Schüler die naturräumlichen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten von Räumen erfassen und bewerten. Dieses führt zu einem vertieften Verständnis dafür, dass Räume unterschiedliche Entwicklungspotentiale haben, aber auch besondere Herausforderungen in sich tragen. Mithilfe von Raumanalysen und Bewertungen sollen die Schülerinnen und Schüler dazu angeregt werden, Entwicklungsprozesse auf lokaler, regionaler und globaler Ebene kritisch zu hinterfragen und auf Nachhaltigkeit zu untersuchen.
Mögliche Fragen sind:
- Klimawandel - Fakt oder Fiktion?
- Energiewende - Weiter so wie bisher?
- Bevölkerungsentwicklung - Genug Nahrung für alle?
- Flucht und Migration - Ausmaß, Ursachen, Folgen und Anpassung
- Landnutzungskonflikte in Afrika: Gummi, Biosprit, Rosen und Kaffee für Europa - Geht das?
Wettbewerbe
Wir nehmen in den Jahrgängen 7, 8, 9 und in der Einführungsphase jedes Schuljahr mit allen Klassen und Kursen am Wettbewerb „Diercke-Wissen“ teil.
Außerschulische Lernorte
- Besichtigung des Mercedes-Werkes in Bremen + Ausbildungsmöglichkeiten bei Mercedes (im Rahmen des Wahlpflichtkurses Geographie Jhg. 9: Industrie 4.0)
- Besuch eines Logistik-Unternehmens (Bsp. Reimer Logistics) (ab E-Phase)
- Besuch des Alfred-Wegener-Instituts und Containerhafen in Bremerhaven (Q-Phase)
- Funktionen einer Stadt: Stadtexkursion in und durch Bremen (Q-Phase)
- Teilnahme am „Tag der Logistik“ (ab der E-Phase)
Chemie
Verstehen was die Welt zusammenhält
Zentrales Thema bleibt immer die uns umgebende stoffliche Welt: Ob es nun knallt und stinkt oder Stoffe sich sehr langsam und leise umwandeln. Die Chemie zeigt die Ordnung in dieser Vielfalt der Stoffe um uns herum und wie man mit ihnen arbeiten kann. Wir begreifen, woraus unsere Welt aufgebaut ist und warum Stoffe bestimmte Eigenschaften aufweisen. Das Periodensystem der Elemente passt auf eine Buchseite und liefert doch sämtliche Grundbausteine für alle Stoffe und damit die gesamte uns umgebende Materie.
Wir gewinnen Erkenntnisse durch Experimente und genaues Beobachten. Bei der Deutung der Beobachtungen werden häufig auch Modelle zur Erklärung herangezogen und zwischen der Teilchenebene, Stoffebene und der Alltagsebene gewechselt. Das abstrakte Denken und Verstehen wird dadurch in einem besonderen Maße geschult.
Sorgfältiges und sicheres Arbeiten ist für jeden Naturwissenschaftler das A und O.

Mittelstufe
Jahrgang 8
1. Luft und Feuer
- Luft als Stoffgemisch kennenlernen
- Verbrennungsvoraussetzungen
- Energieumwandlungen
- Oxidation von Metallen und Nichtmetallen
- DALTONsches Atommodell
- Elemente, Verbindungen, Elementsymbole und Formeln unterscheiden
2. Die Erde als Rohstofflieferant
- Metallgewinnung
- Redoxreaktionen
- Analyse und Synthese von Wasser
- Brennstoffzelle
Jahrgang 9
1. Chemie im Haushalt
- Elementfamilien
- Periodensystem
- Atombau
- Einführung in Säuren und Basen
- Einführung in die organische Chemie
2. Wasser und andere Lösungsmittel
- Bindungsarten
- Lewis-Formeln
- Elektronenpaarabstoßungsmodell
- Polarität und Dipol
- Wasserstoffbrückenbindungen und VAN-DER-WAALS-Kräfte als zwischenmolekulare Wechselwirkungen
- Einfache Kohlenwasserstoffe

Oberstufe
E-Phase (Jahrgang 10)
Der Chemieunterricht in der E-Phase erfolgt dreistündig. Er soll auf den Unterricht in der Qualifikationsphase vorbereiten und wissenschaftspropädeutisch ausgerichtet sein. Die fachlichen Inhalte der E-Phase lassen sich zwei Rahmenthemen zuordnen:
- Energie und Energieträger
- Natur- und Kunststoffe
Neben der Vermittlung fachwissenschaftlicher Inhalte sollen im Unterricht auch immer Bezüge zur Lebenswelt deutlich werden. So werden z.B. im Rahmen des Themenbereichs „Energie und Energieträger“ Akkus und Batterien, sowie alternative Energien und Energieträger behandelt. Im Rahmen des Themenbereichs „Natur- und Kunststoffe“ werden z.B. schädliche Umweltauswirkungen halogenierter Verbindungen thematisiert.
Q-Phase (Jahrgang 11 und 12)
Der Bildungsplan für die Qualifikationsphase im Fach Chemie beinhaltet elf verschiedene Themenbereiche. Im Laufe der Qualifikationsphase werden im Grundkurs sieben, im Leistungskurs neun dieser Themenbereiche behandelt. Die genaue Auswahl der Themenbereiche erfolgt durch die Fachlehrer gemeinsam auf Basis der Abiturthemen.
Verschiedene Zugangswege, Anwendungsgebiete und Vertiefungsbereiche der einzelnen Themenbereiche ermöglichen es, neben den reinen Sachinhalten auch Einblicke in technischen Anwendungen, lebensweltlichen Fragestellungen oder die Wissenschaftsgeschichte zu gewinnen.
Folgende elf Themenbereiche sieht der Bildungsplan vor:
- Grundlagen des chemischen Gleichgewichts
- Protolysegleichgewichte
- Reaktionskinetik und Katalyse
- Energetik
- Elektrochemie
- Aromatische Verbindungen
- Kohlenhydrate
- Aminosäuren, Peptide, Proteine
- Fette und Seifen
- Kunststoffe
- Farbstoffe
Kunst

Mittelstufe
Unser Verständnis des Faches Kunst orientiert sich an der Vielfalt seiner Inhalte. In der Mittelstufe in 5,7 und 9 legen wir die Grundlagen. Hier werden grundsätzliche Techniken vermittelt und anhand von künstlerischen Beispielen Anregungen gegeben. Außerdem nehmen wir regelmäßig an außerschulischen Kunstprojekten mit der Weserburg und Quartier Bremen teil.
Oberstufe
In der Oberstufe werden in den Kursthemen eine Auseinandersetzung mit Objekten der Bildenden Kunst aus dem breiten Spektrum der Kunstgeschichte und der Kunst der Gegenwart gegeben.
Optische Medien, Architektur, Präsentation und Design sind Gegenstand des Unterrichts. Die Beschäftigung mit den unterschiedlichen Epochen und Stilen hat auch eine gesteigerte Sensibilisierung im Umgang mit den Massenmedien heute zum Ziel. Eigenes kreatives Handeln und Denken der Schüler stehen dabei im Vordergrund ebenso wie deren praktische Umsetzung. Die Bereiche Malerei, Druck, grafisches Gestalten und Zeichnungen werden dabei in den Praxisphasen im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Mittel umgesetzt und kunsthistorisch bearbeitet. Grundkurs und Leistungskurs unterscheiden sich nicht von den Themen nur das sich der Leistungskurs vertiefend mit ihnen beschäftigt. Wir wollen vor allem bei den Schülern die Lust wecken, Kunst zu erleben und auszuprobieren. Theorie und Praxis verbinden sich in diesem Fach zu einer einmaligen Symbiose. Wir legen Wert auf Besuche in Bremer Museen und in näherer Umgebung.

Aktuelles aus dem Kunst-Bereich
Das Fach Religion in Bremen
· richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler,
· unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit
und davon, ob sie einer Religion angehören
oder nicht,
· es ist konfessionell nicht an eine bestimmte
Religion oder Weltanschauung gebunden.
Damit ist der Unterricht nicht auf Bekenntnis- oder Glaubensvermittlung ausgerichtet.
Zusammensetzung unserer Klassen und Kurse im Fach Religion
Das Fach Religion wird bei uns gemeinsam mit allen Schülerinnen und Schülern einer
Klasse unterrichtet.
In der Oberstufe kann Religion als Grund- und Leistungskurs angewählt werden.
Die Klassen und Kurse am Alexander-von-Humboldt Gymnasium sind in der Regel sehr `bunt´ zusammengesetzt: Dabei stehen innerchristliche und innermuslimische Vielfalt neben der Vielzahl anderer Religionen und ebenso nehmen Schülerinnen und Schüler am Fach Religion teil, die sich gegen eine religiöse Bindung entscheiden.
Was wird unterrichtet?
Der Religionsunterricht ist zuständig für Fragestellungen, die im Bereich ethischer, religionsphilosophischer und religionswissenschaftlicher Arbeitsgebiete liegen.
Schülerinnen und Schüler erhalten im Religionsunterricht die Möglichkeit, sich mit

· Wert-, Sinn- und Orientierungsfragen,
· Glaube und Religionsgemeinschaften,
· Glaubensfreiheit und Religionskritik
zu beschäftigen und auseinanderzusetzen;
dabei haben gelegentlich auch Kontroversen
und Konflikte ihren Platz.
Als allgemeinbildendes, benotetes und in der Oberstufe abiturrelevantes Fach ist der Religionsunterricht religiös-weltanschaulich neutral, wenn auch nicht wertneutral.
Der Unterricht soll nicht gekennzeichnet sein von einer Beliebigkeit der Überzeugungen, Positionen und Konzepte. Er soll vielmehr helfen, Urteilsfähigkeit zu stärken und begründete Wertorientierungen zu entwickeln.
Englisch
Englisch öffnet uns nicht nur die Tür zu sehr verschiedenen Ländern sowie zu Medien und Büchern weltweit; es ist heute schwierig, nur einen einzigen Tag zu verbringen, ohne in Berührung mit der modernen Fremdsprache Nr. 1 zu kommen.
Der Englischunterricht setzt auf eine systematische Entwicklung und Förderung der kommunikativen Kompetenz und interkulturellen Handlungsfähigkeit in praktischen Anwendungsbezügen. Er bezieht sich auf die im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen formulierten Ansprüche an international gültige Qualifikationen in einer Fremdsprache. In allen Jahrgängen wird die ausgewogene und gleichmäßige Entwicklung des Hör- und Leseverstehens, des Sprechens und des Schreibens in der Fremdsprache gefördert. Die Kompetenzen Lesen, Schreiben, Hören und Mediation werden ab 2017 auch im Abitur abgefragt.
Mittelstufe
Jahrgang 5 und 6
- Systematische Weiterentwicklung der in der Grundschule bereits angelegten Kompetenzen
- Weiterentwicklung von Strategien und Arbeitstechniken zum Sprachenlernen: u.a.
- Sprechen: Alltägliche Sprechsituationen werden im Dialog/Rollenspiel geübt.
- Schreiben: Entwicklung der Schreibfertigkeit anhand von kurzen Beschreibungen (Personen, Gegenstände, Hobbies, Tiere, Orte) etc.
- Sprachmittlung: Einfache Übungen zum sinnhaften Übertragen vom Englischen ins Deutsche.
- Vermittlung von Eindrücken anglophoner Kulturen
- In den unteren Jahrgangsstufen orientiert sich der Englischunterricht zunächst stärker an der sprachlichen Progression, eingebunden in die direkt erfahrbare Umwelt. Die methodischen Kompetenzen werden systematisch weiter entwickelt.
- Bis Ende der 6.Klasse erreichen die SchülerInnen die Niveaustufe A1 (entspricht der Fähigkeit elementarer Sprachverwendung)
Jahrgang 7 und 8
- Verschiebung der Schwerpunkte auf die inhaltlich- thematische Ebene
- Festigung und Vertiefung der bereits in Jahrgang 6 erworbenen Kompetenzen
- Strategien und Techniken werden zum immer selbstständigeren Erlernen der Fremdsprache bewusst genutzt.
Jahrgang 9
- Festigung grundlegender Kenntnisse und der Erweiterung der erworbenen
- Kompetenzen unter verstärkter Betonung interkultureller Handlungsfähigkeit:
- Hörverstehen: Stärkung der direkten Kommunikationsfähigkeit. Informationen sollen zu weiterem sprachlichen und nichtsprachlichen Handeln verwendet werden können.
- Sprechen: Vorbereitete Präsentationen und kleine Vorträge.
- Lesen: Anwendung von Lesestrategien zur analytischen Auseinandersetzung mit problemorientierten Texten.
- Schreiben: Selbstständiges Verfassen umfangreicherer Texte zu überwiegend vertrauten Themen. Dazu gehören auch berufsorientierte Texte wie Lebenslauf, Bewerbung (formaler Brief).
- Sprachmittlung: Verwendung authentischen Textmaterials; schriftliche und mündliche Vermittlung von Inhalten; auch wörtliche Übersetzungen.
- Bis Ende der 9. Klasse erreichen die SchülerInnen A2 / B1 (entspricht der Fähigkeit selbstständiger Sprachverwendung).
Oberstufe
E-Phase (Jahrgang 10)
- Die Entwicklung fremdsprachlicher Diskursfähigkeit vollzieht sich auf der Grundlage einer exemplarischen Auseinandersetzung mit fachlich-gesellschaftlich relevanten Themen, u.a.:
-
- Lebens- und Erfahrungswelt Heranwachsender, Alltags- und Berufswelt
- öffentliches Leben der Bezugskulturen (interkulturelle Kompetenz)
- bis Ende der 10. Klasse erreichen die SchülerInnen B1 / B2 (entspricht der Fähigkeit selbstständiger Sprachverwendung).
Q-Phase (Jahrgang 11 und 12)
- In der Q-Phase werden weitere allgemeine Themen von gesellschaftlichem Interesse untersucht. In der Vergangenheit haben sich die Kurse zum Beispiel mit Science and Technology, Gender Matters, the American South oder Globalisation beschäftigt.
- Englisch kann als Leistungskurs oder als Grundkurs gewählt werden. Als Leistungskurs wird Englisch sowohl im Profil A (mit Darstellendem Spiel und Politik) oder als freier Leistungskurs angeboten. Im gewählten Profilkurs schreiben die SchülerInnen mit P5 ihre wissenschaftliche Arbeit, die ins Abitur eingeht. Im Leistungskurs setzen sich die SchülerInnen intensiv mit einem Drama von Shakespeare auseinander.
- Im Grundkurs erreichen die SchülerInnen B1/B2.
- Im Leistungskurs erreichen die SchülerInnen B2 bis zu B2+ oder C1 (entspricht selbstständiger bis kompetenter Sprachverwendung. C1 entspricht einem fortgeschrittenen Kompetenzniveau).
Die Geschichtsschreibung ist die Unfallchronik der Menschheit.
Charles Maurice de Talleyrand (1754 - 1838), französischer Bischof, Staatsmann und Außenminister
Historia magistra vitae. Die Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens.
Cicero, De Oratore, II 36
Im Fach Geschichte erlangen die Schüler Kenntnisse über Entwicklungen, Ereignisse und Persönlichkeiten, welche die Vergangenheit geprägt haben und damit auch noch heute das Leben in der Gegenwart beeinflussen.
Mittelstufe
Jahrgang 5 und 6
Unsere Reise durch die Historie beginnt in Klasse 5 im Rahmen des Faches WUK mit den Anfängen unserer Geschichte – unsere Schüler befassen sich hier u.a. mit Themen wie der Steinzeit, dem alten Ägypten oder der griechischen und römischen Antike.
Jahrgang 7, 8 und 9
Das eigentliche Fach Geschichte wird ab Klasse 7 unterrichtet. Chronologisch lernen die Schüler der Sekundarstufe I die facettenreichen Dimensionen der Geschichte vom Mittelalter bis hin zur Gegenwart. In Jahrgang 7 beschäftigen sich die Schüler beispielsweise mit mittelalterlichen Strukturen, erfahren, wie Städte entstehen und lernen u.a. wie die Menschen einst lebten.
In Jahrgang 8 tauchen sie ein in die Welt des Absolutismus: sie lernen Persönlichkeiten wie Ludwig XIV oder aber Marie Antoinette kennen, sie beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Revolutionen, insbesondere mit der französischen und der deutschen. Sie entdecken die deutsche Geschichte, erfahren, wie das deutsche Nationalbewusstsein wächst; zudem erfahren sie, inwiefern die französische und die deutsche Geschichte miteinander verknüpft sind.
In Jahrgang 9 vertiefen die Schüler ihre Kenntnisse die deutsche Geschichte betreffend: sie erfahren, wie Bismarck das deutsche Kaiserreich prägte; erarbeiten, wieso Europäer die Welt erobern und sich im 1. Weltkrieg feindlich gegenüber stehen. Die Schüler lernen, wie sich Deutschland nach 1918 stabilisierte und erkennen die negativen Seiten der Weimarer Republik, welche schlussendlich zum 3. Reich führten.
Oberstufe
In der E-Phase wird das chronologische Verfahren weitergeführt: die Schülerinnen und Schüler erarbeiten nun den 2. Weltkrieg in alles Facetten und erfahren, wie sich in der Nachkriegszeit ein eiserner Vorhang entwickelte. Sie bearbeiten die doppelte Staatsgründung, erarbeiten in dieser Phase das Blocksystem und diskutieren, inwiefern man von einem Kalten Krieg reden muss. Die Wiedervereinigung ist ebenfalls ein wichtiges Thema dieser Jahrgangsstufe.
Der Geschichtsunterricht in der Q-Phase richtet sich nach den Themenschwerpunkten entsprechend den verbindlichen curricularen Vorgaben der Behörde. In der Sekundarstufe II geht es insbesondere um historische Kontroversen, dabei werden differente Sichtweisen auf die Geschichte hinterfragt und Ursachen für gegensätzliche Auffassungen ergründet. Neben der Festigung des historischen Wissens üben sich die Schüler auch im historischen Argumentieren, sodass sie befähigt werden, sich ein umfassendes Geschichtsbewusstsein anzueignen um ggf. eine mündliche oder schriftliche Abiturprüfung erfolgreich zu bestehen.
Exkursionen - Museumstag
Im Rahmen des Museumstags besuchen alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule nach und nach Ausstellungen, geschichtlich bedeutsamen Stätten und Museen in Bremen und der weiteren Umgebung. Zusätzlich werden im Rahmen der Projektwoche in Jahrgang 6 und des Oberstufenunterrichts weitere Exkursionen angeboten.
Unterricht
Geschichte wird in der Sekundarstufe I zweistündig unterrichtet. In der Oberstufe handelt es sich um einen dreistündigen Grundkurs. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Leistungskurs zu belegen, welcher fünfstündig ist. Unser Fachbereich arbeitet mit der Reihe ‚Geschichte und Geschehen’.
Spanisch
Spanisch wird - neben Französisch und Latein - als zweite Fremdsprache ab Klasse 6 angeboten. Spanisch kann bei ausreichender Anwahl außerdem in der Oberstufe fortgesetzt, oder auch als neue Fremdsprache aufgenommen werden.
Mittelstufe
Das Erlernen des Spanischen beschränkt sich, so wie auch bei anderen Fremdsprachen nicht auf den reinen Spracherwerb, sondern bezieht sich auch auf den jeweiligen landeskundlichen Kontext und schließt ebenfalls das interkulturelle Lernen mit ein. Der Ablauf kann je nach Lehrbuch etwas variieren.
Die Schüler sollen sich dabei die folgenden Kompetenzen aneignen:
Jahrgang 6
- kurze Dialoge mit vertrautem Wortschatz zu Themen wie Familie, Herkunft, sich Vorstellen, meine Freunde und Aktivitäten verstehen.
- die unterschiedlichen Begrüßungsformen kennen und richtig anzuwenden.
- den Alltag span. und südamerikanischer Jugendlicher und deren Familien kennen.
- Unterschiede im Sprachgebrauch zwischen Lateinamerika und Spanien kennen.
- das Ausbreitungsgebiet der spanischen Sprache und etwas über die amerikanische Geografie kennen.
- globale und detaillierte Informationen aus Hörtexten über bekannte Themen wie das Jugendzimmer, die Wohnung, den Wohnort und einen Wohnort in Spanien sowie landestypische Gerichte und Feste verstehen.
- Feste und Traditionen sowie Rezepte Spaniens kennen.
Jahrgang 7
- die Vielfältigkeit Lateinamerikas kennen.
- detailliert über sich und das persönliche Umfeld sprechen und andere danach fragen.
- über Orte detailliert sprechen.
- Wochentage und Uhrzeit erfragen.
- den Tagesablauf schildern.
- Telefonate verstehen.
- kleine Texte (Emails, Postkarten, Wegbeschreibungen) über eine Region oder Ferien selbst schreiben.
- ein einfaches Telefongespräch auf Spanisch führen.
- einen erweiterten Wortschatz zum Thema Ferien, Schule und Aktivitäten in ausgewählten Regionen Spaniens und Lateinamerika erwerben.
- Texte über Vorlieben anderer, Freizeitgestaltung, Gewalt an Schulen verstehen.
Jahrgang 8
- Angaben zu vorherrschenden Musikrichtungen in Spanien und Lateinamerika machen.
- etwas zu essen bestellen, die Rechnung erbitten.
- Wegbeschreibungen (Straße, U-Bahn) verstehen.
- einen spanischen Stundenplan verstehen.
- Unterschiede zum deutschen System erkennen.
- Über Vergangenes berichten können.
- die Vorteile/bzw. Unverzichtbarkeit von Fremdsprachen (Hier Spanisch) in diversen Berufen erkennen (Praktikum oder Studium in Spanien o. Lateinamerika).
Jahrgang 9
- anhand von gekürzten Originaltexten einen Einblick in ausgewählte Orte der Karibik und der Andenregion bekommen.
- einen kurzen Überblick über die Geschichte Lateinamerikas wiedergeben.
- Chile als Beispiel für den Süden Lateinamerikas und seine verschiedenen Klimazonen kennen.
- Wetter beschreiben, Monate und Feiertage benennen.
- die spanischen Regionen und ihre Besonderheiten benennen.
- Lebensläufe und Steckbriefe von sich selbst in Spanisch abfassen und verstehen.
- spanische Gedichte lesen und verstehen.
Oberstufe
Spanisch für AnfängerInnen
Wir bieten in der E-Phase einen 4 stündigen Anfängerkurs für SchülerInnen an, die noch keine 2. Fremdsprache belegt haben.
Die Themenbereiche, die im Bildungsplan für die Jahrgänge 6 – 10 beschrieben sind, gelten auch für die Gymnasiale Oberstufe; allerdings werden die Inhalte der Altersstufe angepasst und das Lerntempo ist zügiger gestaltet.
Die SchülerInnen können in Spanisch eine mündliche Abiturprüfung ablegen.
Spanisch als fortgesetzte zweite Fremdsprache
A Universelle Themen der Menschen
- Adolescencia e identidad
- La convivencia de las generaciones
- Roles de género
- La vida laboral en un mundo globalizado
B Aktuelle Lebenswirklichkeit in der spanischsprachigen Welt
- España y sus jóvenes
- Turismo y problemas estructurales
- El proceso autonómico en España
- Inmigración y emigración
C Geschichtliche Entwicklungsprozesse von zentraler Bedeutung für die spanischsprachige Welt
- La conquista de América
- La Segunda Repúblicva y la guerra civil
- La revolución cubana y su repercusión mundial
D Mensch und Gesellschaft im Spiegel von Literatur, Kunst und Medien
- Diego Rivera y Frida Kahlo
- Cuentos urbanos de Latinoamerica
- Canciones
- La novela española y el cine
Die o.a. Inhalte bilden nur eine Möglichkeit ab.
E-Phase (Jahrgang 10)
Hier wird zusätzlich zum Kompetenztraining noch verstärkt Wert gelegt auf die Wiederholung und Vertiefung von Vokabular und Grammatik.
Qualifikationsphase (Jahrgang 11 und 12)
Die zu behandelnden Themen orientieren sich an den vorgegebenen Themen des Zentralabiturs. Bei einer Teilnahme an der schriftlichen Abiturprüfung, können die Spanischnoten statt der Englischnoten in die Qualifikation eingebracht werden.
Schüleraustausch
Kursübergreifend (9. Klasse, E-Kurs und Q1) organisieren wir einen Schüleraustausch von 8 Tagen mit unserer Partnerschule in Alicante.
Sport
Das Fach Sport wird von Jahrgang 5 – 12 verbindlich für alle Schüler bei uns an der Schule zweistündig unterrichtet (in Jahrgang 5 dreistündig). Jetzt ist es Realität: Nach mehrjähriger Abstinenz kommt der Leistungskurs Sport zurück und zwar gleich als Sport-Profil „Verstand in Bewegung“. Er ersetzt den 4-stündigen Sport-Grundkurs. Mit dem Standort des Gymnasiums am Stadtrand von Bremen haben wir im Vergleich zu anderen Gymnasien einen großen Vorteil hinsichtlich der Nutzung der z. T. öffentlichen Flächen als Ergänzung für das Hallenangebot, die sich in unmittelbarer Nähe des Schulgrundstücks befinden. Hierzu zählen: das Gelände des Sodenmattsees, die Bezirkssportanlage Huchting (Leichtathletik-Stadion, Rasen-Fußballplatz) und weitere Grünanlagen. Alles ist von der Schule fußläufig in 5-10 Minuten zu erreichen. Außerdem grenzt das Hallenbad Huchting direkt an das Schulgrundstück, wodurch die Schüler keinen langen Anreiseweg zum Schwimmen haben.
Ferner haben wir selbst eine Dreifachturnhalle für die Hallenangebote zur Verfügung und teilen uns zusätzlich die Dreifachturnhalle des TUS Huchting mit zwei Oberschulen.
Mittelstufe
|
Klasse 5 |
Klasse 6 |
Klasse 7 |
Klasse 8 |
Klasse 9 |
|
2* Das Spielen entdecken - Kleine Spiele Schwerpunkt: Reboundball |
6* Bewegen im Wasser - Schwimmtechniken u.a. |
1* Fit sein und fit bleiben - Ausdauer |
2* Spielen - Badminton |
2* Spielen - Einführung in das Volleyballspiel |
|
3* Laufen, Springen, Werfen, Stoßen - Leichtathletik |
4* Bewegen an und mit Geräten - z. B. Sprung am gr. Kasten/Bock |
2* Spielen - Basketball |
3* Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik |
2* Spielen - Floorball |
|
5* Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten - z. B. Akrobatik, kleinere Choreographien beim Bodenturnen |
2* Spielen - Fußball |
2* Spielen - Einführung in das Spiel Floorball (verkürzt) |
5* Bewegen an und mit Geräten - z. B. Parcours und/oder Parallelbarren |
5* Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten - z. B. Rope Skipping |
|
8* Kämpfen - Ringen und Raufen (Zweikampfformen; spielerisches Kämpfen) |
|
2* Spielen - Rückschlagspiele (außer Badminton!!) - Low-T-Ball - Tischtennis (Speckbretter) |
|
|
|
Reboundball |
Fußball |
Schwimmfest |
Badminton |
Floorball |
Über den Sport werden ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler gefördert. Ausgehend in Jahrgang 5 davon, wichtige Regeln gemeinsam festzulegen und den Fair-Play-Gedanken in den Mittelpunkt zu stellen, werden zunächst „kleine Spiele“ erprobt.
Anhand der Verteilung der Inhalte gegliedert nach den entsprechenden Jahrgängen wird deutlich, dass Sport unterschiedlichste Bewegungs- und Sinnerfahrungen ermöglicht. In Jahrgang 6 findet in einem halbjährlichen Wechsel der Schwimmunterricht geschlechtergetrennt statt. Fett hervorgehoben sind die einzelnen Turniere des Jahrgangs, in denen alle Klassen an einem Turniertag den Jahrgangssieger ermitteln.
Oberstufe
E-Phase (Jahrgang 10)
In der E-Phase werden unter anderem die großen Sportspiele wie Basketball oder Volleyball wiederholt. Ergänzend dazu wird in der Regel im Rahmen der Bewegungsfelder „Fitness“ bzw. „Laufen, werfen und springen“ eine Einheit zum Aspekt Ausdauer durchgeführt.
Q-Phase (Jahrgang 11 und 12)
Während in der E-Phase Sport noch im Klassenverband stattfindet (wie in der Mittelstufe), wählen die Schüler ihre Kurse der Qualifikationsphase (Jahrgänge 11 und 12) anhand eines Wahlbogens. Hier geben sie den entsprechenden Bewegungsfeldern ein Ranking (je beliebter das Bewegungsfeld bzw. das Spiel, desto kleiner die Zahl). Unterschieden wird hier zwar nach Sportspielen und Individualsportarten, entscheidend sind aber die Bewegungsfelder, von denen mindestens zwei verschiedene für die Zulassung zum Abitur belegt werden müssen. Grundsätzlich wird darauf geachtet, dass möglichst alle Bewegungsinhalte im Laufe der Qualifikationsphase mindestens einmal stattgefunden haben.
|
Sportspiel |
Rangfolge (1-7) |
Individualsport |
Rang- folge(1-8) |
|
Bewegungsfeld „Spiele“ |
Bewegungsfeld „Fit sein und fit bleiben“ Fitness |
|
|
|
Badminton |
|
Bewegungsfeld „Bewegen an und mit…“ Gerätturnen |
|
|
Basketball |
|
Bewegungsfeld „Bewegen an und mit…“ Trampolin |
|
|
Fußball |
|
Bewegungsfeld „Laufen, Werfen, Spri…“ Leichtathletik |
|
|
Tischtennis |
|
Bewegungsfeld „Bewegen im Wasser“ Schwimmen |
|
|
Volleyball |
|
Bewegungsfeld „Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten“ Tanz |
|
|
Handball |
|
Mögliche Bewegungsfelder „Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten“ oder Bewegungsfeld „Fit sein und fit bleiben“ Aerobic |
|
|
Hockey |
|
Bewegungsfeld „Fahren, Gleiten, Rollen“ Kanu |
|
Wettbewerbe
JtfO (Jugend trainiert für Olympia)
BARMER GEK-Cup (Hallenfußballturnier für Mädchenmannschaften)
Werder-Cup (Fußballturnier für Partnerschulen)
Berufsorientierung
Projekt Stadionschule bei Werder Bremen (in Jahrgang 9)
Aktuelles aus dem Sport-Bereich
Latein
Einst war Latein als Muttersprache der „alten“ Römer die Weltsprache der Antike und hat dadurch überall in Europa seine Spuren hinterlassen. Ebenso war es die Sprache der Wissenschaft in der Zeit der Aufklärung. Dies sieht man bis heute in der medizinischen und juristischen Fachsprache.
Die gesprochene Sprache im Unterricht ist in der Regel Deutsch. Im Unterricht werden lateinische Texte ins Deutsche übersetzt. Dabei lernt man die Welt der alten Römer mit den antiken Göttern, den Gladiatoren, den Wagenrennen und vielem mehr durch Geschichten kennen.
Da im Unterricht sehr viel Wert auf den korrekten Ausdruck im Deutschen gelegt wird, bietet Latein vielen Schülerinnen und Schülern die Chance, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.
Mittelstufe
Jahrgänge 6 bis 9
In der Mittelstufe erwerben Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Kenntnisse in der Grammatik, im Vokabular und über die römische Kultur. Dabei arbeiten sie zunächst mit dem eingeführten Lehrbuch aber auch schon mit 2000 Jahre alten Originaltexten.
Oberstufe
In der Oberstufe werden die grundlegenden Sprachfertigkeiten anhand von Originaltexten vertieft. Im Mittelpunkt stehen aber vielmehr die Lebens- und Gedankenwelt der Römer. Die Schülerinnen und Schüler erhalten hier Einblicke in die antike Geschichtsschreibung, Dichtung, Philosophie und Politik. Dies geschieht oft anhand von Texten, die Spuren in der europäischen Kultur hinterlassen haben.
Besonderheiten
Interessierte Schülerinnen und Schülern nehmen am Bundesfremdsprachenwettbewerb teil.
Darüber hinaus erwerben die Schülerinnen und Schüler am Ende von Jg. 10 bei ausreichender Leistung das sog. KMK-Latinum. Dies ist ein lebenslang gültiges Zertifikat, das häufig noch in Studiengängen wie Geschichte, romanischen Sprachen, Sprachwissenschaften usw. verlangt wird.
NW (Naturwissenschaften)
Das Fach Naturwissenschaften (NW) vereint die Fächer Biologie, Chemie und Physik. Naturwissenschaftliche Phänomene werden hier sowohl fächerübergreifend als auch fachspezifisch unterrichtet. Der NW-Unterricht findet im 5. und 6. Jahrgang statt und stellt eine wesentliche Grundlage für die weiteren ab Klasse 7 unterrichteten MINT-Fächer dar.
Im Fach NW versuchen wir naturwissenschaftlichen Fragestellungen auf den Grund zu gehen und diese mit vielen Experimenten möglichst praxisnah zu veranschaulichen. Dazu gehört es, Hypothesen aufzustellen, diese im Versuch zu überprüfen und daraus Ergebnisse abzuleiten.
Eine Besonderheit des NW-Unterrichtes ist, dass dieser möglichst in Halbgruppen stattfindet, wodurch ein grundlegendes praktisches Arbeiten mit den entsprechenden Laborgeräten und Materialien eingeübt werden kann, wie zum Beispiel der sichere Umgang mit dem Gasbrenner.
Mittelstufe
Jahrgang 5 und 6
- Stoffe erkunden
- Pflanzen und Tiere kennen lernen
- Elektrische Energie nutzen
- Gesund bleiben
- Mit dem Wasser leben
- Erwachsen werden
Projekte
Das Umfeld unserer Schule, wie der Sodenmattsee und der Park links der Weser, bietet vielfältige Möglichkeiten für Exkursionen an. So wird in wiederkehrenden Abständen das Projekt „Kinder als Gewässerexperten – Untersuchung und Pflege von Gewässerstrukturen“ durchgeführt. Dieses Umweltbildungsangebot findet in Kooperation mit dem Träger Arbeit und Ökologie und dem Verein Park links der Weser statt. Hier haben Kinder die Möglichkeit, Tiere und Pflanzen direkt in ihren Lebensräumen zu erforschen und erste Schritte in Richtung wissenschaftliche Freiarbeit zu machen.
Letzte Beiträge
- 2025-11: Besuch aus Brasilien bei der VBK1
- 2025-11: Der LK Geschichte besucht das Staatsarchiv
- 2025-11: "KI und wir" - der Welttag der Philosophie 2025
- 2025-11: Der Future Parcours macht wieder Halt am AvH
- Für Ehemalige
- 2025-10: Besuch beim LK Geschichte der Q2
- 2025-10: Wir waren wieder am "Museumstag" unterwegs
- 2025-10: Einladung zum Workshop "Jugend debattiert"
- 2025-09: Die Vertretungen der Schüler:innen wurden gewählt!
- 2025-09: Diagnostiktag und Fortbildung des Kollegiums
- 2025-09: Landesnetzwerktreffen von „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“
- 2025-09: Jg. 7 besucht die "Explore Science"
- 2025-09: Infoveranstaltung vom Jugendbeirat Huchting
- 2025-09: Einladung zum Infotreffen von "Jugend debattiert"
- 2025-09: Spieltagsbericht - Auftakt der Community Champions League
Ihre Auswahl
TagCloud
JugendAktionsBüro

Schule - und dann? Berufsorientierung Bremen
B I L D U N G S S P E N D E R
Sekretariat der Mittelstufe
Tanja Ueberschär
Montag - Mittwoch und Freitag 8:00 bis 14:15 Uhr
Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr
Telefon: 0421 361-16696
Fax: 0421 361-59620
Email: 307@schulverwaltung.bremen.de
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Delfter Straße 16
28259 Bremen
Sekretariat der Oberstufe
Sandra Rosin
Montag bis Donnerstag 7:30 bis 13:30 Uhr
Freitag 7:30 bis 12:00 Uhr
Telefon: 0421 361-16470
Fax: 0421 361-16709
Email: 307@schulverwaltung.bremen.de
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Delfter Straße 16
28259 Bremen